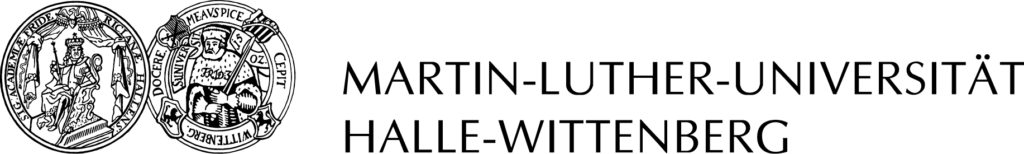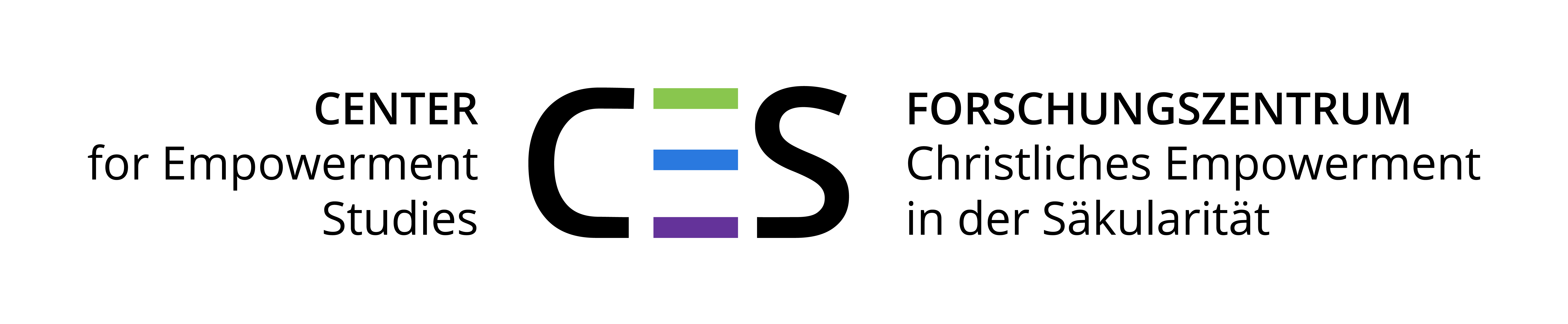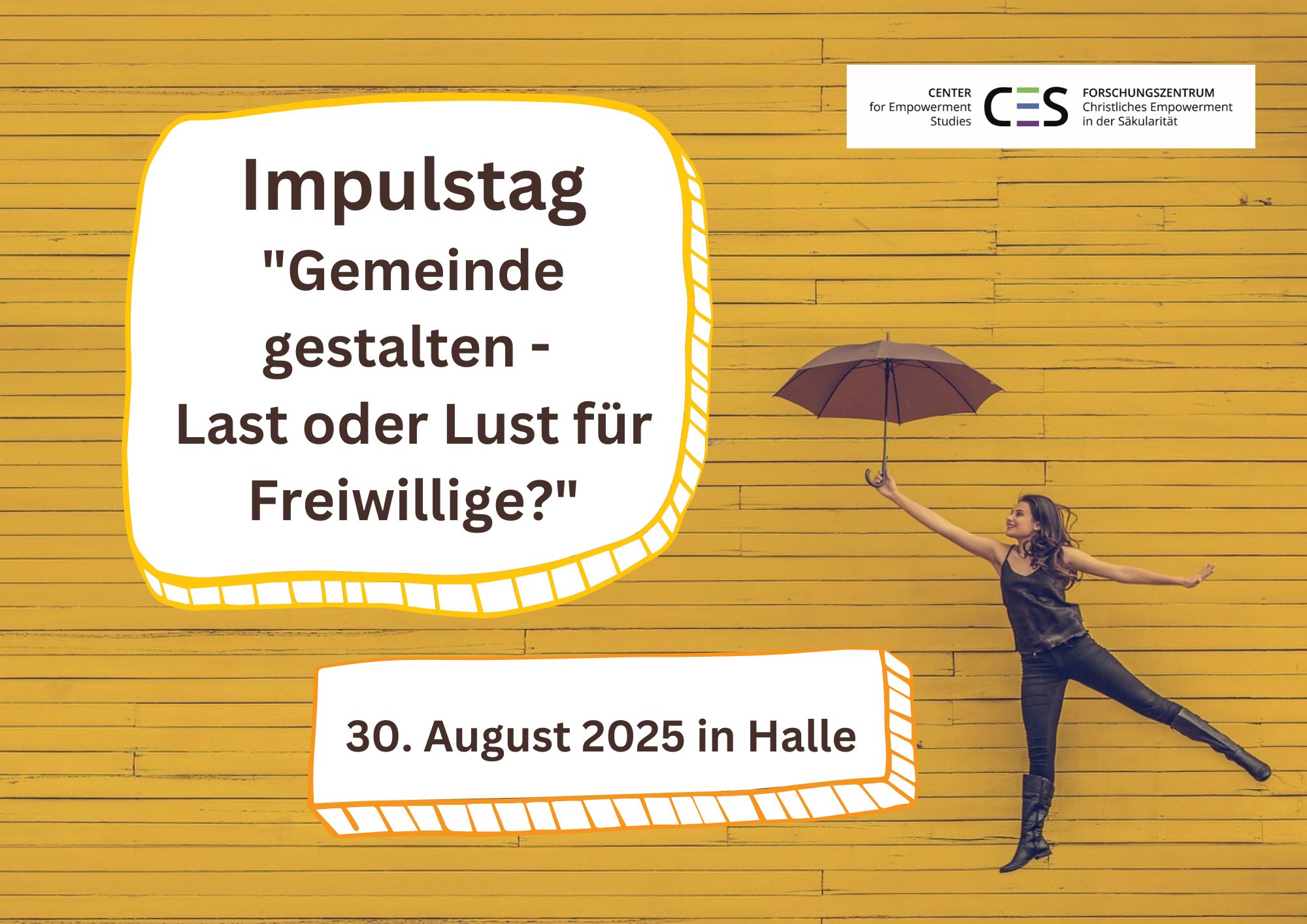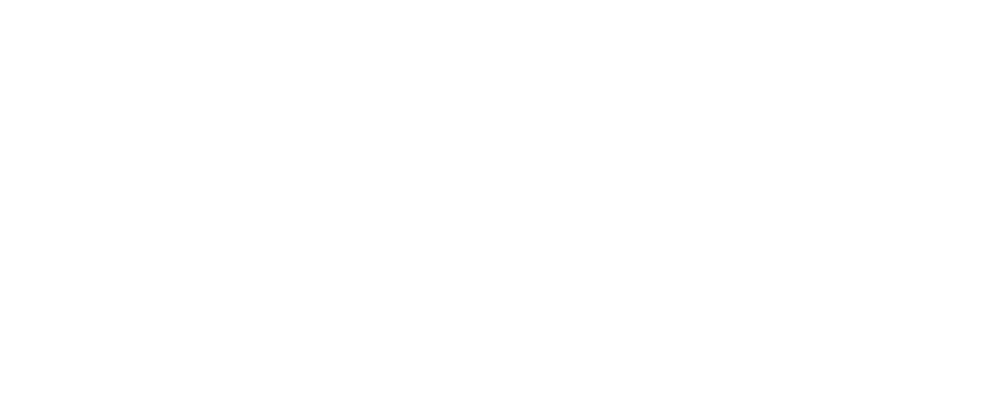Unsere Studienreise in die Niederlande stand unter dem Leitgedanken, wie kirchliches Leben in einer vielfältigen Gesellschaft gestaltet werden kann. Im Fokus standen regionale Kirchenentwicklung, Pionierprojekte und der Umgang mit Diversität. Inspirierende Gemeinden und innovative Projekte eröffneten neue Perspektiven für die Gemeindearbeit.
Besonders beeindruckend war die kreative und selbstverständliche Arbeit der Pionierinnen und Pioniere. In meinem Bericht möchte ich zentrale Erkenntnisse und Fragen teilen, wie Vielfalt als Gewinn in unseren Gemeinden gestaltet werden kann. Bereits zu Beginn wurde deutlich, dass unsere Gruppe sowohl aus verschiedenen Professionen als auch Studiengängen besteht und genauso vielfältig waren auch die Fragen zu Organisation, Erreichbarkeit, Ansprechbarkeit und Übertragbarkeit der Projekte auf den eigenen Kontext.
Unser erstes Treffen führte uns zu „City to City Amsterdam“, wo wir uns mit urbaner Gemeindegründung beschäftigten. Dabei traten die Herausforderungen zutage, spirituelle und seelische Themen in der heutigen Gesellschaft anzusprechen. Anschließend bei der „Gist“ Community nahmen wir an einer Brotmeditation teil und sprachen über das Projekt, das traditionelle Handwerkserfahrung wie das Brotbacken als Zugang zum Glauben bietet. Besonders bereichernd war die Offenheit der Community bezüglich der Interpretation ihrer Angebote, die auch eine nicht-religiöse Deutung willkommen heißt.
Am Mittwoch besuchten wir die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) und vertieften uns in deren Mission und Projektarbeit. Ein Workshop zu „Frame Innovation“ zeigte, wie Pioniere in ihren Projekten begleitet werden.
Am Donnerstag tauschten wir uns an der Theologischen Fakultät Utrecht über die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und die Ausbildung protestantischer Pfarrer*innen aus. Besonders die „Messy Church“ und neue Wege ins Pfarramt wurden thematisiert.
Freitag stand im Zeichen monastischer Gemeinschaften. Im Kleiklooster beeindruckte uns die Verbindung von Diakonie und gemeinsamem geistlichen Leben. Bei „Taste“ erlebten wir gelebte Nachbarschaft beim Abendessen.
Am Samstag besuchten wir einen Amsterdamer Stadtteil ohne Kirche, in dem eine Pionierin durch Gespräche im Café eine neue Gemeinde gründete. Auch über Fusionsprozesse und deren Bedeutung für das Miteinander wurde diskutiert.
Der letzte Tag bot die Möglichkeit, Gottesdienste frei zu besuchen. Die Erfahrung zeigte mir, dass Liturgie auch über Sprachgrenzen hinweg verbindet. Beim internationalen Gottesdienst in Gouda lernten wir außerdem, dass nicht alle Pionierprojekte an die Protestantse Kerk Nederland (PKN) gebunden sind.
Die Auswertung ergab, dass viele Projekte in Deutschland ähnlich funktionieren, jedoch eine stärkere Unterstützung der Pioniere durch die Landeskirchen nötig wäre. Verwaltung und Struktur bleiben für kleine Gemeinden herausfordernd.